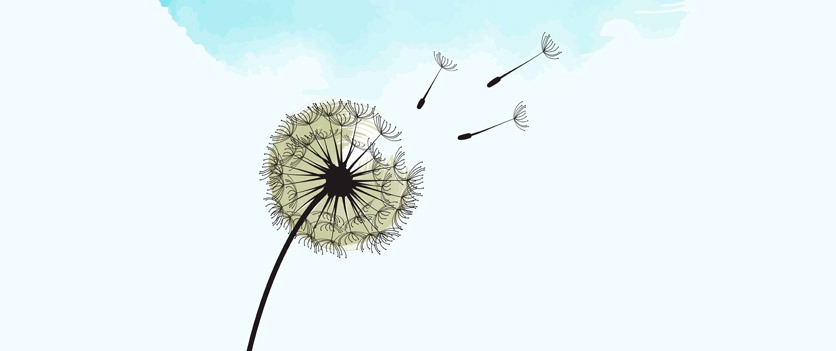
Tod & Trauer in Zeiten von Corona
Sterbende begleiten und Abschied nehmen ist eine herausfordernde
Aufgabe. Die wegen der Pandemie verordnete Distanz und beschränkte Kontaktmöglichkeiten erschweren sie zusätzlich. Das Leid von Angehörigen
ist gross.
Text: Usch Vollenwyder
Es ist eines der letzten Fotos von Esther Kienast: Sie steht am Rand einer Wiese mit verblühtem Löwenzahn, einen Stängel in der Hand, die Augen geschlossen, die Lippen leicht gespitzt – im nächsten Augenblick wird sie sanft pusten und die Schirmchen davonfliegen lassen. Eines fliegt über das Foto hinaus und schwebt über der Todesanzeige: «Esther Kienast-Karrer, 14.5.1928 bis 20.1.2021.» Zehn Tage zuvor war bei der 92-Jährigen das Coronavirus nachgewiesen worden. «Ich habe geweint und konnte nicht mehr aufhören», erinnert sich ihre Tochter Dorothe Kienast an den Moment, als sie vom positiven Resultat hörte.
Während ihr Bruder Niklaus sofort zur Mutter ins Pflegezentrum fahren wollte, brauchte sie einen Moment Zeit, bis sie wieder festen Boden unter den Füssen spürte: «Was auch immer jetzt geschieht, es gehört zum Leben.» Dorothe Kienast war sich des Risikos einer Ansteckung bewusst, als sie sich entschied, ihre Mutter durch die letzten Tage zu begleiten. Dankbar ist sie den Mitarbeitenden für den Freiraum, der ihr und ihrem Bruder in dieser Zeit gewährt wurde. Wie auch immer das Geschwisterpaar den Abschied gestalten wollte – ihre Bezugsperson im Pflegezentrum ermunterte sie: «Ihr müsst nichts. Ihr dürft alles.»
Dorothe Kienast übergab die anstehenden Aufgaben in ihrem Kommunikationsunternehmen den Mitarbeitenden und organisierte den Fernunterricht für ihre Lektionen an der Berufsschule. Danach sass sie abwechselnd mit ihrem Bruder am Sterbebett ihrer Mutter. Mit Schutzkleidung und Maske, Schutzbrille und Handschuhen. Noch habe ihre Mutter sie erkannt, wenn sie die behandschuhte Hand auf ihren Arm oder ihre fiebrige Stirn legte und ihr letzte Worte zuflüsterte. Dorothe Kienast fühlte sich bestärkt, weil sie von herzlichen und kompetenten Pflegenden unterstützt wurde: «Ihre Ruhe und ihre Achtsamkeit unserer Mutter und uns gegenüber bleiben mir unvergessen.»
Seit vier Jahren wohnte Esther Kienast im Pflegezentrum Drei Tannen im zürcherischen Wald. Von Anfang an sei das Leben ein Miteinander von Bewohnenden, Pflegenden und Angehörigen gewesen. Besuche – auch Dorothe Kienasts Hündin Emilou – waren jederzeit willkommen. Während des harten Lockdowns im letzten Frühling hatte das Heim mit Fotos und Anrufen den Kontakt zu den Angehörigen aufrechterhalten. Auch jetzt: Das heimeigene Büsi durfte auf der Bettdecke der Sterbenden schlafen. Dorothe Kienast weinte mit einer jungen Praktikantin, als diese sagte: «In kurzer Zeit habe ich dreizehn Menschen sterben sehen.» Sie redet von «Gnade», wenn sie an diese letzten intensiven Tage denkt und zweifelt, ob sie den Abschied so bewusst erlebt hätte, wenn das Leben ihrer Mutter langsam erloschen wäre.
Allein und isoliert
Erst in dieser Zeit erfuhr Dorothe Kienast, dass eine offene Kommunikation und der Einbezug von Angehörigen – soweit es die Pandemiesituation zulässt – längst nicht in allen Institutionen eine Selbstverständlichkeit ist. Aus Angst vor dem Virus haben sich vor allem während der ersten Welle viele Alters- und Pflegeheime, aber auch Spitäler von der Aussenwelt abgeschottet. Über Wochen waren kranke, alte und betreuungsbedürftige Menschen von ihren Angehörigen weitgehend isoliert. Einigermassen Konsens herrschte nur bezüglich der Begleitung von Sterbenden: Dort sollten Besuche – wenn auch unter strengen Auflagen – möglich sein.
«Sterben und Abschiednehmen sind an sich schon nicht einfach», sagt Isabelle Noth, Theologieprofessorin mit Schwerpunkt Seelsorge und Spiritual Care an der Universität Bern. «Doch jetzt ist dieser Prozess wegen der Pandemie und der geltenden Vorschriften um ein Vielfaches erschwert» (siehe Interview Seite 16). Isabelle Noth weiss, dass diese schwierige Situation für viele Angehörige kaum auszuhalten ist: «Daran gibt es nichts zu beschönigen. Man kann nur versuchen, sie etwas aufzufangen.» Schwierig ist sie nicht nur für die Angehörigen der vielen Corona-Opfer, sondern auch für Familien und Freunde all der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an Krebs oder einem Herzinfarkt, an einem Unfall, einem Hirnschlag oder aufgrund ihres Alters gestorben sind.
«Ich gehe zu meinem Mann, ihr könnt mir die Polizei und den Spitaldirektor nachschicken»
Franziska Matter
Wenn Franziska Matter* an die letzten Wochen mit ihrem Mann Fritz denkt, spürt sie nichts als eine grosse Wut: «52 Jahre waren wir verheiratet, wir haben zwei Töchter grossgezogen, ein Geschäft geführt und waren einander zugetan – im Guten wie im Schlechten.» Als Fritz einige Jahre nach seiner Pensionierung an Krebs erkrankte, war es selbstverständlich, dass seine Frau ihn zu den Therapien begleitete, mit den Ärzten sprach, ihn jeden Tag im Spital besuchte. Immer mehr war er auf ihre Fahrdienste und ihre Übersetzerrolle angewiesen: Nach einer Innenohrerkrankung hatte auch sein Gehör deutlich nachgelassen.
Und dann kam Corona.
Von nun an hatte Franziska Matter im Auto zu warten – während jeder Chemotherapie, jeder Untersuchung, jedem Arztgespräch. Die Restaurants waren zu, selbst der Zugang auf die spitaleigene Toilette wurde ihr verwehrt. Als ein weiterer Klinikaufenthalt unumgänglich wurde, herrschte
ein Besuchsverbot. Informationen gab es nur noch spärlich. Als Fritz Matter auf die Intensivstation verlegt wurde, stürmte die sonst so sanfte Achtzigjährige an den diensthabenden Zivilschützern vorbei: «Ich gehe zu meinem Mann, ihr könnt mir die Polizei und den Spitaldirektor nachschicken.» Sie sah ihren Mann erst wieder, als er auf die Palliativstation verlegt wurde: Zwei Mal am Tag durften sie oder eine ihrer Töchter ihn während maximal einer halben Stunde besuchen.
Wut und Trauer
Franziska Matter ist dankbar, dass das kompetente Personal auf der Palliativabteilung des Kantonsspitals darüber hinwegschaute, wenn eine
ihrer Töchter sie begleitete. Es blickte auch nicht auf die Uhr, wenn die offizielle Besuchszeit überschritten wurde. Am letzten Tag durfte sie weit in den Abend hinein bei ihrem Mann bleiben, er war wach, sie konnte ihn umarmen, liebe Worte hätten sie gewechselt. Franziska Matter und ihre
Töchter waren bei Fritz, als er starb – friedlich und ruhig. Doch es wurde Weihnachten, mehr als ein halbes Jahr später, bis sich ihr Zorn über die harten Vorschriften gelegt hatte und sie endlich zur Ruhe und auf andere Gedanken kommen konnte.
Für die Theologin Isabelle Noth ist wichtig, dass Wut und Trauer über die aktuelle Situation und die strengen Schutzmassnahmen aus- und angesprochen werden. Das sei entlastend und mache bewusst: «Ich bin nicht allein.» Dann erst lasse sich nach Formen suchen, wie ein Abschied im Rahmen des noch Möglichen gestaltet werden könne. Für Trauergottesdienste sind laut Bundesratsbeschluss maximal fünfzig Gäste zugelassen – jedoch nur, wenn dabei der Abstand eingehalten werden kann. Friedhofskapellen und Aufbahrungshallen bieten in der Regel entsprechend weniger Platz. Ein Leidmahl ist nicht möglich. Corona zwingt die Hinterbliebenen, auf traditionelle Beerdigungen und Abdankungen zu verzichten.
Viele Todesanzeigen in der Zeitung verweisen auf einen Abschied im kleinsten Kreis. Manchmal wird zu einer späteren Gedenkfeier eingeladen, «erst wenn Nähe und Umarmungen wieder möglich sein dürfen», steht über der Todesanzeige eines 85-Jährigen. Hin und wieder folgt der Hinweis, dass die Abdankung via Video oder Live-Stream übertragen wird. Wo öffentlich zu einer Abschiedsfeier eingeladen wird, müssen sich die Gäste mit Namen, Adresse und Telefonnummer anmelden. Eine Trauerfamilie schreibt in der Todesanzeige ihres Vaters: «An oder mit Corona, wen interessiert’s, er ist nicht mehr da.» Es tönt traurig und resigniert.
«Mir fehlt der sonst so herzliche Umgang im Freundeskreis mit Umarmungen und Nähe»
Dorothe Kienast
Dorothe Kienast ist der Pfarrerin dankbar, die beim Trauergespräch zu ihr und ihrem Bruder sagte: «Corona gibt Ihnen die Möglichkeit, den traditionellen Rahmen zu verlassen.» Eine kirchliche Abschiedsfeier wird voraussichtlich im Mai – in der Zeit rund um den Geburtstag ihrer Mutter – stattfinden. Einerseits ist Dorothe Kienast froh, muss sie jetzt nicht Gastgeberin für die Abdankung und das anschliessende Essen sein. Andererseits fühlt sie sich unendlich einsam: «Mir fehlt der sonst so herzliche Umgang im Freundeskreis, mit Zusammensein, Umarmungen und Nähe.»
Die Urnenbeisetzung fand am 9. Februar statt – im kleinsten Kreis: Sie, ihr Bruder Niklaus, eine Cousine, die Pfarrerin. Schnee lag über den Gräbern – Schnee, den ihre Mutter geliebt und von dem es in ihren letzten Tagen so viel gegeben hatte. Auf dem Friedhof gab es einen heissen Punsch zu trinken – ohne Corona hätten sie sich das wohl nicht erlaubt, meint Dorothe Kienast. Sie ist sicher: «Mueti hätte es gefallen. Ihr waren Geselligkeit und Verköstigung wichtig.»
Franziska Matter und ihre Töchter ihrerseits versuchten, die Abschiedsfeier im Rahmen der zugelassenen Möglichkeiten zu gestalten. Die Grösse der Kirche erlaubte vierzig Gäste, jede zweite Bankreihe war mit weissem Plastikband abgetrennt, weisse Punkte im Abstand von zwei Metern zeigten, wo sich die Trauernden hinzusetzen hatten. Auf die sonst so selbstverständlichen Traditionen in der katholischen Innerschweiz musste weitgehend verzichtet werden: keine Aufbahrung in der Kapelle, Kondolenzbesuche nur von den allernächsten Verwandten, kein Weihwasser in der Kirche, kein Friedensgruss vor der Kommunion. Kein Kirchenchor und keine Musikkapelle, die den Marsch «Alte Kameraden» spielte.
Abschied ohne Freunde
Nüchtern und auf ein Minimum beschränkt sei der Trauergottesdienst abgehalten worden, sagt Franziska Matter. Ohne Beschränkungen wäre die Kirche zum Bersten voll gewesen: Ihr Mann war ein geselliger, stets optimistischer Mensch gewesen, eingebettet in einen grossen Freundes- und Bekanntenkreis. Dieser konnte beim letzten Abschied nicht dabei sein. Franziska Matter vermisste die Umarmungen der vielen Menschen, die ihr gezeigt hätten: «Wir sind dir nah.» Kraft gaben ihr die Töchter und engste Verwandte, die sie mit ihrer Fürsorge durch die schwere Zeit begleiteten.
«Wenn ihr an mich denkt, denkt an die Stunde, in der ihr mich am liebsten hattet.» Dieses Zitat von Rainer Maria Rilke steht auf der Danksagungskarte unter dem Foto von Fritz Matter. «Die Erinnerung an Berührung und Nähe kann in dieser von Abstand und Distanz geprägten Zeit ein grosser Trost sein», sagt Theologieprofessorin Isabelle Noth. Die Vorderseite der Karte zeigt ein Foto des alten Apfelbaums auf der Wiese vor Fritz Matters Elternhaus. Seine ausladenden Äste und das grüne Blätterdach strecken sich weit über den Bildrand hinaus – Symbole für Hoffnung und Lebenskraft. ❋
*Name von der Redaktion geändert
Interview mit Isabelle Noth:
«Symbole vermitteln Zusammengehörigkeit»
Die Pandemie verbietet traditionelle Abdankungen. Gefragt sind andere Formen. Theologieprofessorin Isabelle Noth weiss, wie schwer der Abschied unter diesen Umständen sein kann.
Das Thema interessiert Sie?
Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.
Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».