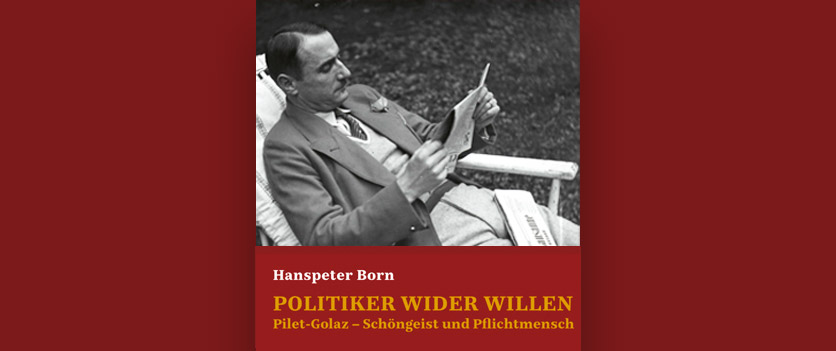Auszug aus «Das Wiener Dekameron» Von Christoph Braendle
Auf dem Rosenhügel zu Wien, zwischen dem Schönbrunner und dem Hetzendorfer Schlosspark und in der Nähe des Hetzendorfer-, des Hietzinger- und des Südwestfriedhofs befand sich ein grosses Haus, eine mächtige Villa eigentlich, die in ein Heim für betagte Menschen umgestaltet worden war. An die drei Dutzend ältere Herrschaften aus guten Familien hatten dort ein Zuhause gefunden.
Im Zuge bestimmter Ereignisse verarmten die meisten, und auch ihre Familien waren zu keiner Unterstützung mehr befähigt. Die Ersparnisse dieser Leute waren schneller dahingeschmolzen als der Schnee unter der Frühlingssonne, und einer nach dem anderen hatte ausziehen müssen, weil die Miete für das Zimmer und die Preise für Verpflegung und Pflege unbezahlbar geworden waren. In den leeren Hallen und Fluren machte sich Trübsal breit. Nur sieben Damen und drei Herren blieben übrig. Sie verharrten Tag und Nacht auf ihren Zimmern, haderten mit dem Schicksal und fürchteten sich vor dem Leben noch viel mehr als vor dem Tod.
An einem Dienstagvormittag gellte Feueralarm durchs Haus. Die Insassen begaben sich, so wie es mehrmals geübt worden war und so schnell es ihnen ihr Zustand erlaubte, hinab in die grosse Eingangshalle und durch die Tür hinaus in den Garten. Die Älteste, eine rüstige Mittachtzigerin, erwartete sie dort und gestand gleich, den Alarm selber ausgelöst zu haben, um sie alle hier zu versammeln.
Ich würde die wahren Namen dieser Leute nennen, hielte nicht ein guter Grund mich davon ab. Ich wünsche nämlich nicht, dass eine von ihnen oder irgendeiner ihrer Nachkommen sich schämen müssten um der Geschichten willen, die sie erzählt und angehört haben und die ich in der Folge mitteilen werde. Üble Nachrede soll nicht den guten Ruf dieser ehrenwerten Herrschaften schmälern. Um jedoch ohne Verwirrung unterscheiden zu können, wer was sagte, will ich ihnen Namen geben, die vielleicht auch ihren Eigenschaften entsprechen und die es uns ermöglichen, ein besseres Bild zu gewinnen.
Nennen wir die erste und im Alter am meisten vorgerückte Dame, die Greisin also, die den Alarm ausgelöst hatte und jetzt mit ihrer Erklärung begann, nennen wir sie Dorothee. Die zweite Edeltraud, den ältesten Herrn Carl, den nächsten Andreas, dann Maria Luisa und Emma, Rudi als jüngsten Herrn, schliesslich Olga, Nora und zum Schluss Elsa, die mit ihren vierundfünfzig Jahren eigentlich zu jung für die Pension war, aber, da sie nie geheiratet und keine Familie hatte, hier schon eine Weile wohnte, weil sie als eine Art Privatsekretärin von Carl damit beschäftigt war, für ihn Briefe zu schreiben, die er nie abschicken liess.
Dorothee war fünfundachtzig Jahre alt und zu einem kleinen, zähen Weiblein geschrumpft, das allerdings immer noch über einen eisernen Willen verfügte. Sie war nie verheiratet gewesen und hatte auch nie Kinder gehabt, aber es ging das Gerücht, dass sie in jüngeren Jahren zahlreiche Affären gehabt habe, und hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, einer ihrer Liebhaber habe sich in den Tod gestürzt, nachdem sie ihn verlassen hatte. Dorothee selber äusserte sich dazu nicht. Die Torheiten der Jugend, sagte sie höchstens, indem sie die Augen himmelwärts verdrehte. Sie lebte schon seit fast zwanzig Jahren auf dem Rosenhügel, und es gab niemanden, der ihre scharfe Zunge nicht gefürchtet und ihre Position als höchste Autorität des Hauses bestritten hätte.
Die zweiundachtzigjährige Edeltraud hingegen war eher ein mütterlicher Typ. Sie hatte zweimal geheiratet und sich zweimal scheiden lassen. Ihre vier Kinder hatten ihr sieben Enkel geschenkt, die sie nie sah, da die Familie über die Welt verstreut lebte und die einzelnen Mitglieder kaum Kontakt miteinander pflegten. Carl war neunundsiebzig, ein langer, hagerer Mann mit schlohweissem Haar. Er war Professor an der juristischen Fakultät der Universität Wien gewesen, bevor er emeritierte. Er war das, was man früher einen alten Hagestolz genannt hatte. Unverheiratet ein Leben lang, pflegte er ein unklares Verhältnis mit seiner Privatsekretärin Elsa, die ihm wohl irgendwie hörig war.
Der siebenundsiebzigjährige Andreas wiederum war ein gemütlicher Herr mit dickem Bauch, der gerne viel ass und noch mehr trank. Er war verwitwet. Sein einziger Sohn war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, eine Tragödie übrigens, die auch seine Frau ins Grab gebracht hatte. Er besass eine schöne Stimme, auf die er sich einiges einbildete, und er sang leidenschaftlich gerne und nicht nur in der Badewanne. Auch Maria Luisa, ebenfalls siebenundsiebzig, war verwitwet. Sie war eine bekannte und beliebte Ärztin gewesen, hatte sich aber nach einem Schlaganfall ganz aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Ihre zwei Töchter lebten in London und Chicago und beschränkten ihren Kontakt mit der Mutter darauf, ihr zu Weihnachten eine Karte zu schicken.
Emma, zweiundsiebzig Jahre alt, konnte sich nach mehreren Hüftoperationen nur an Krücken fortbewegen. Sie redete am liebsten davon, wie unerträglich ihr ganzes Leben gewesen sei. Sie hatte mit drei Ehemännern sieben Kinder gehabt, von denen allerdings nur drei das Erwachsenenalter erreichten, und auch aus diesen dreien war nichts Gescheites geworden. Rudi, einundsiebzig Jahre alt, war Buchhalter in einem mittelständischen Unternehmen gewesen, bis man ihn während einer der vielen Wirtschaftskrisen, die dem grossen Zusammenbruch vorangegangen waren, in Frühpension schicken musste. Er hatte das nicht wirklich verkraftet und war so griesgrämig geworden, dass seine Frau ihn verliess und seine drei Kinder den Kontakt abbrachen.
Die neunundsechzigjährige Olga hingegen war eine fröhliche und dralle Person. Sie entstammte einer sehr feinen Familie und hatte einen Mann geheiratet, der sie abgöttisch geliebt und ihr jeden noch so verrückten Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Ihr gemeinsamer Sohn hatte schon sehr früh bewiesen, dass er über die besten Anlagen verfügte. In der Familie stritt man sich, ob er eine Karriere als Pianist oder als Chirurg anstreben solle. Leider kam es weder zum einen noch zum anderen: Vater und Sohn stürzten mit einem Sportflugzeug ab und kamen ums Leben.
Olga gab sich hernach der Frömmelei hin und fand in der fünfundsechzigjährigen Nora eine Verbündete, die ebenfalls gerne in Kirchen ging und auf den Knien lag, allerdings eher aus gegenteiligen Gründen: Sie war eine ziemlich hässliche und leicht verwachsene Frau, die ihr ganzes Leben lang nie die Begehrlichkeit eines Mannes zu wecken imstande gewesen war und ihre Sehnsucht deshalb auf den gekreuzigten Jesus und andere Märtyrer projizierte.
Von der vierundfünfzigjährigen Elsa haben wir bereits berichtet. Carls Privatsekretärin war eine hübsche, üppige Blondine, der man ein durchschnittliches Leben als Hausfrau und Mutter zugetraut hätte, wenn sie nicht ihrem Professor in einem Ausmass verfallen gewesen wäre, das man Hörigkeit nennen musste. Obwohl das schon seit zwanzig Jahren so ging, war man allgemein überzeugt, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis nie in eine sexuelle Beziehung gemündet war.
Diese zehn Leute kamen im Garten der Pension am Rosenhügel zusammen.
«Liebe Freundinnen und Freunde», sagte Dorothee, nachdem sie die Sache mit der Alarmanlage erklärt hatte, «ich habe zu viel erlebt in meinem Leben und gesehen, wie das Unglück reitet und galoppiert und mit lästigem Ungestüm durch die Strassen zieht. Ich habe mich nie brechen lassen und gedenke das auch in dieser schlimmen Zeit nicht zu ändern, sogar wenn ich vermuten muss, dass auch wir bald zu den Opfern gehören, denen alles genommen wird, was uns lieb und teuer ist. Wenn ich allerdings sehe, wie sich alle vor lauter Angst und Furcht in ihren Zimmern verkriechen und kaum die Tür zu öffnen wagen, weil noch ein Entsetzen davorstehen könnte, und wenn ich höre, wie sich jeder den ganzen Tag und den grössten Teil der Nacht mit Unsäglichkeiten berieseln lässt, bis der Kopf dröhnt und die Augen schmerzen und die Niedergeschlagenheit unermesslich geworden ist, dann fühle ich mich verpflichtet, etwas zu tun. Ich will uns aus diesem Schlamassel herausreissen. Ich will, dass wir die Spinnweben aus unseren Seelen schütteln und wieder so etwas wie Lebensfreude empfinden, und sei es nur für kurze Zeit.»
Sofort setzte ein Stimmengewirr ein, in dem neben ein bisschen Zustimmung viel Widerspruch laut wurde. Man habe keine Zeit, klagten die meisten, keine Lust, keine Kraft, keine Idee. Man habe nicht das Recht und nicht die Mittel und nicht die Möglichkeit, sich in diesen tristen Zeiten zu vergnügen. Dorothee hob die Hand und bat, man möge ihren Vorschlag hören und bedenken. «Unser Garten ist, wie ihr seht, sonnig», sagte sie, «er lädt zum Verweilen ein. Brett- und Kartenspiele stehen zur Verfügung. Jeder könnte sich vergnügen. Und doch sitzen alle immer nur auf ihren Zimmern. Ich schlage vor, dass wir uns zehn Tage lang nach dem Mittagessen hier versammeln. Nicht zum Spielen allerdings, weil der Gewinner zwar fröhlich, der Verlierer aber grimmig wird, und nicht zum Plaudern, da unsere Plaudereien immer zu den Umständen führen, die Ursache unseres Unglücks sind. Statt uns über unsere Leiden auszutauschen, sollten wir uns Geschichten erzählen. Geschichten sind etwas Wunderbares. Wenn einer redet, kann sich die ganze Gesellschaft ergötzen, und die Zeit vergeht wie im Flug. Noch ehe alle mit ihrer Geschichte an die Reihe gekommen sind, neigt sich die Sonne. Danach kann immer noch jeder gehen und tun, was ihm gefällt.»
Carl fragte, an was für Geschichten Dorothee denke. Sie schwieg einen Augenblick. Dann sagte sie: «Wir sind alt. Wir gehören zum rostigen Eisen. Man hat uns abgeschoben, weil wir nutzlos und lästig sind. Aber ich fühle mich nicht alt, ich habe auch mit meinen fünfundachtzig Jahren Bedürfnisse, die sich vielleicht nicht mehr heftig in den Körper drängen. Aber der Kopf möchte sich gerne vergnügen. Lasst uns schöne, wilde, schlimme Geschichten erzählen, in denen es um die Lust geht und um Leidenschaft, Verführung, Frivolitäten und Exzesse, um den Kampf der Geschlechter, um Siege und Niederlagen im Liebesspiel.»
Einen Moment lang herrschte überraschtes Schweigen. Dann ging es wieder los, das Stimmengewirr, das diesmal aus ebenso vielen Meinungen wie Anwesenden bestand. Man sei nicht pervers, hiess es, man könne das nicht, man kenne keine Geschichten dieser Art. Vor allem die jüngeren unter den Damen wehrten sich. Man habe einen Ruf zu verlieren, meinten sie, oder man habe mit schmutzigen Phantasien nichts am Hut. Dorothee hob noch einmal die Hand. «Wir haben nichts zu verlieren», sagte sie, «weil wir schon alles verloren haben. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Nichts davon wird den Rahmen des Gartens verlassen, weil sich ausserhalb des Gartens niemand darum kümmert, was hier drinnen geschieht.»
Sie schlage vor, dass sich alle, die mitmachen wollten, nach dem Mittagessen im Garten versammeln sollten. Thematisch passend zum ersten Tag sollten Geschichten erzählt werden, die vom «ersten Mal» handelten. Sie werde beginnen, danach werde man entsprechend der Reihenfolge im Alter weitermachen. Sprach’s, erhob sich und trippelte davon.
Die anderen schauten einander eine Weile lang sprachlos an. Dann schüttelte Carl den Kopf und sagte, so einen Unsinn habe er schon lange nicht mehr gehört. Rudi meinte, Leut’ vernadern, Leut’ hintergehen und Leut’ korrumpieren, das sei die ganze Erotik in Wien. Elsa nickte eifrig, während Olga und Nora sich bekreuzigten und verkündeten, dass sie mit diesem gottlosen Treiben nichts zu tun haben wollten. Andreas hingegen sagte, dass ihm die Idee, Erotisches aus Wien zu hören, schon gefallen könnte, und auch Edeltraud, Maria Luisa und Emma gaben zu, neugierig zu sein. Sie vermöchten sich tatsächlich Besseres vorzustellen, als immer nur stumpfsinnig auf dem Zimmer zu sitzen.
Man ging auseinander, ohne sich geeinigt zu haben. Jeder ass wie üblich für sich allein.
Nach dem Mittagessen tröpfelten die Bewohner der Pension allmählich in den Garten; sei es, weil sie von Anfang an beschlossen hatten, dabei zu sein, sei es, weil sie sich nun noch viel mehr als üblich langeweilten; sei es, weil sie neugierig geworden waren oder weil sie sich vor den anderen keine Blösse geben wollten. Alle trafen sich auf der freien Rasenfläche in der Nähe eines barocken Brunnens, wohin Dorothee Stühle und Sofas hatte schaffen lassen.
Rosenhecken umringten den Ort. In den Blüten summten Bienen, und vom höchsten Ast eines Kastanienbaumes, der den Platz überschattete, sang eine Amsel ihr Lied. Dorothee sagte, sie sei hoch erfreut, dass man ihrer Einladung Folge leiste, und weil sie am Grund ihres Schrankes eine Flasche mit altem Cognac gefunden habe, bitte sie, mit einem Gläschen auf den Erfolg des Unterfangens anzustossen. Zudem helfe das, die Zungen zu lockern. Bis auf Rudi und Nora, die grundsätzlich keinen Alkohol tranken, nippten bald alle an ihrem Glas, und Dorothee begann mit der ersten Geschichte.
Christoph Braendle, 1953 in der Schweiz geboren, lebt seit 1987 in Wien. Schriftsteller und Essayist. Publikationen in diversen Zeitungen und Zeitschriften; Autor zahlreicher Theaterwerke und Romane, zuletzt «Aus den Augen», erschienen 2019 beim Verlag Bibliothek der Provinz. Leiter des Kreativschreibwettbewerbs Texte. Preis für junge Literatur. Verheiratet und Vater zweier Töchter. www.christophbraendle.net
- Hier gehts zum Vorwort des Buches «Voll im Wind».
- Im Informationsteil werden Themen aus den Buchgeschichten aufgegriffen. Er enthält Tipps und viel Wissenswertes.
- Weitere Geschichten aus dem Buch «Voll im Wind» finden Sie hier.
«Voll im Wind»
Geschichten von A wie Altersheim bis Z wie Zwetschgenschnaps
Grossvater riecht nach Schnaps und Grossmutter lacht nicht mehr. Was ist passiert? «Älterwerden ist kein Spaziergang», erzählen Betroffene – und die Jüngeren nehmen es irritiert zur Kenntnis. Ruth und Fritz haben es doch schön in der Alterswohnung, und Trudi wird im Pflegeheim rund um die Uhr verwöhnt. Was ist daran so schlimm?
Es sind dies die Übergänge und Brüche; vermehrt gilt es, Abschied zu nehmen: vom Haus, vom Partner, vom Velofahren. Das Gehen verändert sich weg von der Selbstverständlichkeit hin zur Übung und Pflicht; das Autofahren ist ohnehin ein Tabu, so will‘s die Tochter. Ist es da so abwegig, den Kopf hängen zu lassen? Sich Pillen verschreiben zu lassen oder ein Glas über den Genuss hinaus zu trinken? Ja, es ist abwegig, weil es auf Abwege führt und nicht auf einen grünen Zweig.
22 Schweizer Autorinnen und Autoren erzählen Geschichten über ältere Menschen, denen der Wind derzeit mit voller Wucht entgegenbläst. Ein Anhang mit einfachen Infos und Tipps sowie weiterführenden Adressen bietet den nötigen Windschutz.

- «Voll im Wind – Geschichten von A wie Altersheim bis Z wie Zwetschgenschnaps», Hrsg. Blaues Kreuz Schweiz, © 2020 by Blaukreuz-Verlag Bern, ISDN 978-3-85580-549-5
- Cover-Illustration: Tom Künzli, TOMZ Cartoon & Illustration, Bern. Lektorat: Cristina Jensen, Blaukreuz-Verlag. Satz und Gestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld. Druck: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
- Das Projekt wird vom Nationalen Alkoholpräventionsfonds finanziell unterstützt. Für Begleitpersonen stehen unter www.blaueskreuz.info/gesundheit-im-alter weitere Fachinformationen zu den Themen des Buches bereit.